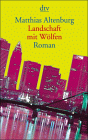MATTHIAS ALTENBURG:
LANDSCHAFT MIT WÖLFEN
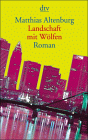
Ein zynisch angelegter Protagonist entdeckt (?) die Welt. Zumindest erfindet
er Frankfurt (a.M.) neu: als absurdes Panoptikum jener beiläufigen Existenzen,
deren heutzutage die Welt (über)voll zu sein scheint.
Die Fülle schräger und blutleerer, verkümmerter Gestalten täuscht nicht
über die Einfallslosigkeit hinweg, der sich der Verfasser bedient hat, um
seine Wenigkeit auszudrücken (die autobiographische Anspielung im Erzähler/Protagonistennamen
"Neuhaus" auf den Verfassernamen "Altenburg" ist nicht zu übersehen). Schwach
religiös verklammerte Spott- und Hohntiraden wechseln mit larmoyanter Geschwätzligkeit,
um einzig und allein einem unreflektierten nihilistischen Grundgefühl Ausdruck
zu geben, das einmal den bislang zurückgehaltenen "gelben Hustenschleim"
loswerden will.
Ja: Es sind Spuren gelegt in Hülle und Fülle. Tiermotive - ein quasi barocker
Vanitas-mundi-Gestus, biblisch-religiöse Einsprengsel. Aber all das gelingt
nicht zu einer Einheit, sondern fährt auseinander zu einer widerwärtigen
und gefühllos heruntergeschriebenen Plattitüde, die zusammenhangslos nach
einem Leser sucht, der sich nicht die Mühe machen will, etwas Bedeutsames
zu entdecken. Selbst das darbegotene Menschenbild ("homo homini lupus")
ist nicht neu.
Der Roman liest sich wie eine exemplarische Bestätigung dieser Annahme bzw.
Theorie. Altenburg eifert möglicherweise seinem Vorbild und Übervater Houellebeqc
nach - und bleibt damit ebenso nichtssagend wie dieser. Er zeigt allenfalls,
daß die Literatur heute, wenn sie sich nicht auf Werte zurückbesinnt, verstümmelt
und defizitär bleiben wird. Wo nur noch abbildend-naturalistisch (allerdings
in perspektivisch-vereinseitigter und verengter Form) ein Gesellschaftsausschnitt
dargeboten wird, bleibt Literatur hinter ihrer Möglichkeit und ihrem Auftrag
zurück: die Welt zu verändern und zu gestalten.
In diesem Roman wird nur noch schulterzuckend und resigniert das Handtuch
geworfen vor einer scheinbaren Faktizität, die der Leser als "hingekotzten"
Auswurf konsumieren darf. Mag sein, daß gelegentlich Widerwille oder andere
Emotionen aufkommen: Eindeutig werden sie jedoch nicht. Der abschließende
Showdown (konjunktivisch als Möglichkeit verschleiert) bringt weder Reinigung
noch Erlösung, sondern ist ein zusätzlich belastendes Faktum, das dem Erzählten
in dumpfer Addition hinzuzufügen ist.
Abgesehen davon, daß die Fäkaliensprache Altenburgs jeden einigermaßen zivilisierten
Menschen anwidern muß, dringt das Erzählen niemals in eine reflektierende
und das Erzählte hinterfragende Distanz vor. Der zur Genüge dargebotene
Sarkasmus reicht nicht zur Ironie. Wo z.B. die Banalität einer Party-Konversation
gezeigt werden soll, wird lediglich unreifer Spott ausgeschüttet, statt
eine distanzierte Bloßstellung zu versuchen.
Die misanthropische Grundstimmung des Romans ist nicht neu. Dergleichen
kennt man z.B. aus Schnitzlers Erzählungen. Aber in ihnen geht es eben nicht
nur um hilfloses Abbilden, sondern um empörtes Gestalten: Das Falsche, Defizitäre
ist immer Auslöser einer Umkehrbewegung oder zumindest einer definitiven
Ausweglosigkeit, die den Protest des Lesers evoziert. Altenburgs Roman jedoch
zeigt einen vom Leben angewiderten und gelähmten Mittdreißiger, der sich
an einer Reihe von (teilweise treffend gezeichneten) Charakteren abarbeitet,
um zuletzt am selben Punkt, auf dem er bereits zu Anfang stand, einen blassen
Amoklauf zu inszenieren. Es gibt keine Entwicklung, keinen Zuwachs an Erkenntnis.
Dann aber stellt sich die Frage, warum der Protagonist nicht schon zu Anfang
des Romans jenen Punkt erreicht hat, der ihm erst zum Schluß zugestanden
wird. Denn: Nichts, absolut nichts von all den beschriebenen Erfahrungen
trägt irgendwie dazu bei, den Fortgang und Abschluß der Geschichte plausibel
zu machen. Die in biblisch-mythologischer Analogie inszenierte 7-Tages-Geschichte
bleibt ein unklares und unverbindliches Gemisch aus mehr oder weniger witzigen
und interessanten Einfällen und Beobachtungen.
Zur Gestaltung dieses durchaus ergiebigen Stoffes hat es bei Altenburg nicht
gereicht.
bestellen
Weitere Rezensionen von Hartmut Ernst
zurück