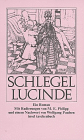FRIEDRICH SCHLEGEL:
LUCINDE
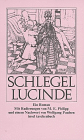
Das seinerzeit (1799) sehr umstrittene und wegen seines angeblichen Plädoyers
für freie Liebe und Lebensgemeinschaften, sowie seines offenkundigen Eintretens
für Libertinage zeitweise zensierte Romanfragment des maßgeblichen deutschen
Frühromantikers ist eigentlich kein Roman nach konventionellen Maßstäben,
obwohl er als solcher firmiert. Der Text entfaltet in zahlreichen Bruchstücken
ganz unterschiedlicher Form und Gattung (Brief, Fantasie, philosophische
Reflexion, Allegorie u.a.m.) die freie und freizügige Liebesbeziehung zwischen
Julius und Lucinde.
Als Experiment einer praktischen Umsetzung der schlegelschen Literaturtheorie
mag der Text weitgehend gescheitert sein; als Dokument der ungeheuer rasanten
und dichten Zeit des frühromantischen Kreises in Jena bleibt er von Interesse.
In seiner Anlage einer auf Zerstörung der Form zielenden Prosa ist das Buch
ein durchaus modernes Buch - und damit seiner Zeit um ein Jahrhundert voraus.
Die Negation des Systems spiegelt sich im Verzicht auf Handlungs- und Charakterentwicklung
und kann als Musterstück romantischer Ironie gelten, insofern das Dargestellte
zugleich seine Reflexion und Aufhebung impliziert. Die seinerzeit kühne
Zertrümmerung der traditionellen Romanform ist noch gesteigert durch unzweifelhafte
autobiographische Elemente des Textes.
Der Roman darf als eines der ersten Zeugnisse der uns heute selbstverständlichen
"romantischen Liebe" gelten: also eines aus dem Gefühl der Zuneigung und
nicht bloßer Pflicht motivierten Zusammenlebens. Daß erst die Romantik (im
Rückgriff übrigens auf christliche Vorstellungen) den Weg von einer (noch
germanisch beeinflußten) rein rechtlichen Eheauffassung zu einer Ehe als
Liebesgemeinschaft endgültig gebahnt hat, wird heute oft vergessen. Das
in der "Lucinde" vertretene Ideal einer "romantischen Ehe" ist als Einheit
von sinnlicher und geistiger Lebensgemeinschaft zu verstehen.
bestellen
Weitere Rezensionen von Hartmut Ernst
zurück