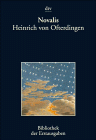NOVALIS:
HEINRICH VON OFTERDINGEN
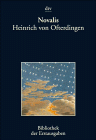
Der Fragment gebliebene (jedoch ursprünglich zur Fortsetzung bestimmte)
Roman Friedrich von Hardenbergs, der besser unter seinem programmatischen
Pseudonym bekannt ist, erschien im Nachlaß 1802 und zerfällt in zwei Teile
("Die Erwartung" und "Die Erfüllung"), die schon aufgrund ihres quantitativen
Ungleichgewichtes keine wirkliche Korrespondenz aufweisen.
Der extrem handlungsarme und dagegen reflexionsreiche Text stellt die Titelfigur
als latente Schriftstellergestalt vor und ist bewußt als Antithese zu Goethes
"Wilhelm Meister" konzipiert; jenes Romans also, der in den Kreisen der
Frühromantiker als das bedeutendste deutsche Werk der Epoche galt. Demzufolge
ist im "Ofterdingen" die Dynamik eines Entwicklungs- und Bildungsromanes
radikal angehalten zugunsten einer zirkulären Auflösung der Handlung in
Metaphorik und Symbolik.
Insbesondere das für die Romantik weiterhin bestimmende Sehnsuchtssymbol
der "blauen Blume" wird in diesem Roman erstmals verwendet. Daß diese Sehnsucht
unbestimmt bleibt, sich also nicht auf ein konkret angebbares Ziel richtet,
sondern sich als ewige Unerfülltheit und Prozessualität realisiert, gibt
dem Text jene Vagheit und Offenheit, die später insbesondere bei Eichendorff
("Ahnung und Gegenwart") zur sentimentalen Gefühlsseligkeit verkommt.
Der Protagonist, der in einer höfisch-mittelalterlichen Welt mit seiner
Mutter per Kutsche zu einem Besuch des Großvaters in Augsburg unterwegs
ist, erfährt in Konversation mit Mitreisenden und in episodenhaften, fast
irrealen Begebenheiten an den Orten der Rast eine innere Reise der Reifung,
von der die äußere Reise nur das sichtbare Abbild darstellt. Der Traum von
der blauen Blume hat als Initiations- und Erweckungserlebnis einen Prozeß
in Gang gebracht, der als Reise nach Innen zu begreifen ist. Das romantische
Motiv vom Hinabsteigen in die Tiefen der Erde, wo der Protagonist seinem
wahren Selbst begegnet und dieses als verborgenen Text eines Buches entdeckt,
verweist bereits auf die Bedeutung, die der psychischen und irrationalen
Wirklichkeit des Menschen innerhalb romantischen Erzählens zukommt.
Vollends in den Bereich des Irrationalen und nicht mehr Erklärbaren ragt
das den ersten Teil beschließende Märchen des Klingsohr von Eros und Fabel
hinein, das sich als Allegorie der Poesie auffassen läßt und dem Protagonisten
zumindest vordergründig die unerfüllbare Liebe zu Mathilde, der Tochter
Klingsohrs, als Bedeutung der blauen Blume vor Augen stellt.
Die Verklärung der Poesie als einer alle Grenzen sprengenden und die gesamte
Natur umfassenden Realität scheint im zweiten Teil des Romans auf, in dem
die Grenzen von Traum und Realität vollends verschwimmen. Es tauchen nur
noch allegorische Gestalten auf, denen eine quasi-mythologische Existenzweise
zukommt.
Der Roman dokumentiert die intensive schriftstellerische Auseinandersetzung
mit dem Wesen der Poesie im Kontext eines "magischen Idealismus", der auch
dem Unbelebten poetische Kraft zumißt und Reifung des Menschen als Weg in
die Abgründigkeit des eigenen Ichs versteht.
bestellen
Weitere Rezensionen von Hartmut Ernst
zurück